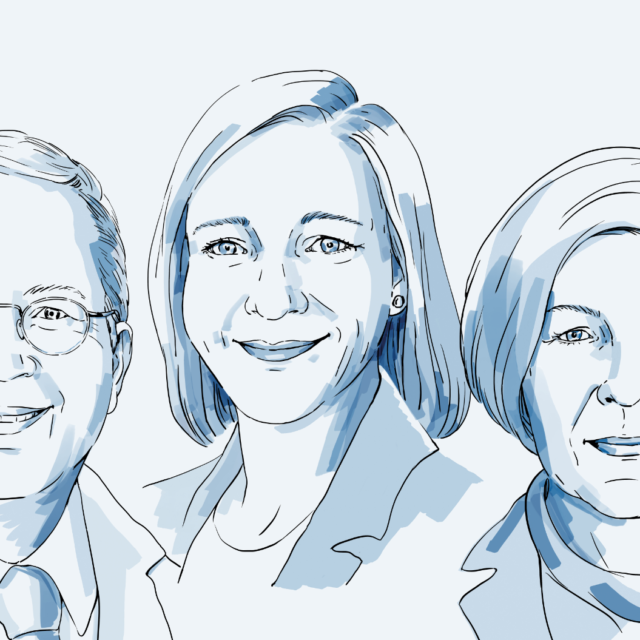Die schönste Zeit des Jahres hat auch Schattenseiten, auch rechtlich gesehen. Es gibt einiges zu beachten. Wo Probleme liegen können, verraten wir hier.
Urlaubszeit und Formularschwindel
Nach der Eintragung im Handelsregister, der Erstellung einer Homepage oder einer Nennung in den “Gelben Seiten” erhalten viele Unternehmen Rechnungen oder Offerten für die Registrierung in Datenbanken. Diese, wie amtliche Vordrucke gestalteten Formulare, haben Ähnlichkeit mit Rechnungen des Amtsgerichts oder des Deutschen Patent- und Markenamtes, DPMA (Einträge im Handelsregister oder in das Register bei dem DPMA). In letzter Zeit häufen sich zudem auch Formulare für die Erstellung einer Internetseite Bei einer anderen Variante kann der Eindruck entstehen, es handele sich um einen Korrekturabzug zu einem schon bestehenden Eintrag. Derartige Angebote können auch aus dem Ausland kommen.
Gerade während der Ferien- und Urlaubszeit werden solche Schreiben versandt. Denn die zu dieser Zeit oft unterbesetzten Buchhaltungen laufen schneller Gefahr, Zahlungen ohne eingehende Prüfung anzuweisen. Einmal überwiesene Beträge sind jedoch nur mit Mühe und Aufwand zurückzuerlangen, sofern der Überweisungsauftrag bei der Bank nicht mehr storniert werden kann.
Die IHK rät daher, gerade Anschreiben von Adressbuchverlagen oder amtlich aufgemachte Rechnungen mit nahem Zahlungsziel und beigefügtem Überweisungsträger besonders gründlich zu überprüfen, wobei auch auf die IBAN auf einem etwa beigefügtem Überweisungsträger geachtet werden sollte. Unter Dok.-Nr. 83146 können weiterführende Informationen, auch zu Vorsorgemaßnahmen, abgerufen werden.
Genehmigung des Sommerurlaubs
Die Sommerurlaubsplanung stellt die meisten Arbeitgeber jedes Jahr wieder vor große Herausforderungen. Eine gute und rechtzeitige Planung ist dabei für einen reibungslosen Betriebsablauf unerlässlich. Welche Grundsätze Sie als Arbeitgeber bei der Planung beachten sollten, wird im Folgenden dargestellt. Die Ausführungen beziehen sich auf die gesetzlichen Regelungen, von denen teilweise durch Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder individualvertragliche Regelungen abgewichen werden kann.
Urlaubsgewährung
Jeder Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf vollen Jahresurlaub nach Ablauf einer sechsmonatigen Wartefrist. Das heißt aber nicht, dass in den ersten Monaten kein Urlaub genommen werden darf, wie viele glauben, sondern nur, dass bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Ablauf der Wartefrist sog. Teilurlaub in Betracht kommt.
Der Anspruch auf Urlaub bedeutet nicht, dass der Arbeitnehmer den Urlaub nehmen kann, wann er will. Eine Selbstbeurlaubung des Arbeitnehmers kann sogar einen Kündigungsgrund darstellen.
Eine Ablehnung eines Urlaubswunsches kommt aber nur aufgrund dringlicher betrieblicher Belange oder aufgrund vorrangiger Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer in Betracht.
Dringliche betriebliche Belange
Für die Begründung entgegenstehender dringlicher betrieblicher Belange genügt es nicht, dass Störungen im Betrieb zu erwarten sind, da diese in der Regel mit dem Fehlen eines Mitarbeiters einhergehen. Es müssen über eine Störung hinausgehende Beeinträchtigungen vorliegen.
Ein Beispiel für das Vorliegen dringlicher betrieblicher Gründe ist ein unvorhergesehener Personalengpass, der aufgrund eines hohen Krankenstandes oder wegen unvorhergesehener Kündigungen anderer Arbeitnehmer auftritt. Ebenso kommt die Eigenart der Branche als betrieblicher Grund in Betracht, zum Beispiel, wenn die Hauptsaison des Betriebes in den Zeitraum des Urlaubswunsches fällt.
In den Fällen dringender betrieblicher Belange muss der Arbeitgeber die Umstände des Einzelfalls betrachten und die widerstreitenden Interessen gegeneinander abwägen.
Kollidierende Urlaubswünsche von Arbeitnehmern
Ein besonders häufiges Problem ist, dass die Urlaubswünsche verschiedener Arbeitnehmer miteinander kollidieren. Die Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer rechtfertigen die Verweigerung des Urlaubs nur, wenn aus betrieblichen Gründen nicht jeder Urlaubswunsch erfüllt werden kann. Welcher Urlaubswunsch Vorrang hat, ist allein unter urlaubsrechtlichen Gesichtspunkten zu bewerten. Dazu zählen u.a. die Urlaubsmöglichkeit des Partners des Arbeitnehmers oder die Ferienzeit schulpflichtiger Kinder.
Die Tatsache, dass ein Arbeitnehmer schulpflichtige Kinder hat, begründet jedoch nicht zwangsläufig einen Vorrang gegenüber Arbeitnehmern ohne Kinder, auch die bisherige Urlaubsgewährung und die Dauer der Betriebszugehörigkeit sind zu berücksichtigen.
Für den seltenen Fall, dass der Arbeitnehmer keine Urlaubswünsche angibt, ist der Arbeitgeber berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Urlaubszeitraum von sich aus zu bestimmen. Der Arbeitnehmer ist in einem solchen Fall nicht gezwungen, sich an die Vorgaben seines Arbeitgebers zu halten. Er kann auch dann noch seine Wünsche äußern und den vom Arbeitgeber festgelegten Urlaub ablehnen.
Dauer des Urlaubs
Das Bundesurlaubsgesetz sieht einen jährlichen Mindesturlaub von 24 Werktage vor. Es geht dabei von einer sechs-Tage-Woche aus. Bei weniger Wochenarbeitstagen verringert sich die gesetzliche Mindestanzahl entsprechend: Bei einer einer Fünf-Tage-Woche ergibt sich ein Mindesturlaub von 20 Tagen.
Der Gesetzgeber geht grundsätzlich von einer zusammenhängenden Gewährung des Urlaubs aus. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer seinen Urlaub zusammenhängend zu gewähren, soweit nicht dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung des Urlaubs erforderlich machen. Kann der Urlaub aus diesen Gründen nicht zusammenhängend gewährt werden, und hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Urlaub von mehr als zwölf Werktagen, so muss einer der Urlaubsanteile mindestens zwölf aufeinanderfolgende Werktage umfassen. Der Arbeitnehmer muss selbstverständlich nicht immer mindestens 12 Werktage am Stück nehmen, sondern kann seinen Urlaub freiwillig stückeln.
Rückgängigmachung des Urlaubs
Der Arbeitgeber ist grundsätzlich an seine Entscheidung, dem Arbeitnehmer für einen bestimmten Zeitraum Urlaub zu gewähren, gebunden. Gesetzlich ist keine Rückgängigmachung in Form eines Widerrufs vor Beginn des Urlaubs oder eines Rückrufs während des Urlaubs vorgesehen. Auch die Rechtsprechung geht sehr restriktiv mit diesem Thema um:
Es ist anerkannt, dass eine einvernehmliche Rückgängigmachung möglich ist, z.B. weil sich die Urlaubspläne des Arbeitnehmers geändert haben. Einseitig kann der Arbeitgeber den Urlaub nur in absoluten Notfällen oder wenn der Arbeitnehmer den Arbeitgeber bzgl. des Urlaubsanspruchs arglistig getäuscht hat widerrufen.
Diese Grundsätze kann der Arbeitgeber auch nicht durch vertragliche Regelungen ausschließen. Eine Abrede zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer während seines Urlaubs zurückrufen kann, ist unwirksam.
Urlaubsentgelt und Urlaubsgeld
Urlaubsentgelt und Urlaubsgeld werden häufig verwechselt. Bezüglich der Abgeltung des Urlaubs ist zwischen dem Urlaubsentgelt und dem Urlaubsgeld zu differenzieren. Das Urlaubsentgelt betrifft den gewöhnlichen Lohnanspruch, der während des Urlaubs des Arbeitnehmers fortbesteht. Dieser bemisst sich an dem Durchschnitt des Arbeitseinkommens der letzten 13 Wochen vor dem Urlaub. Bei der Bemessung bleiben Überstunden und Kürzungen etwa aufgrund von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen o.ä. außer Betracht.
Urlaubsgeld ist eine darüber hinausgehende Bezahlung, die gesetzlich nicht vorgesehen ist, aber aufgrund von tarifvertraglichen, betrieblichen oder individualvertraglichen Regelungen zusätzlich gezahlt werden kann.
Weitere Informationen zum Thema „Urlaubsrecht“ erhalten Sie unter Dok.-Nr. 25359.
Eiscafé & Co.
Sondernutzung
Eine häufig insbesondere im Sommer erfolgende Inanspruchnahme öffentlicher Flächen durch aufgestellte Tische und Stühle ist als sog. Sondernutzung öffentlichen Raumes erlaubnis- und kostenpflichtig und wird durch die gemeindlichen Sondernutzungssatzungen geregelt.
Grundsätzlich benötigen Unternehmen für alle Anlagen der Außenwerbung eine Genehmigung der jeweiligen Stadtverwaltung. Das bedeutet, dass nicht nur von Eiscafé auf öffentliche Plätze herausgestellte Tische und Stühle, Informationsstände, sondern auch einfache Stellschilder und Werbetafeln z.B. vor einem Ladengeschäft nicht ohne weiteres aufgestellt werden dürfen.
Dabei sind abhängig vom jeweiligen Ort Einschränkungen aus Gründen des Denkmalschutzes, der Verkehrssicherheit oder möglicher Beeinträchtigungen denkbar. Insbesondere ist darauf zu achten, dass Fußgänger und Radfahrer nicht behindert oder gar gefährdet werden. Schon ein Fahrradständer auf dem Bürgersteig bedarf daher der Erlaubnis, erst recht z.B. sog. “Nasenschilder”, die über Kopfhöhe in den Verkehrsraum hineinragen.
Für folgende Arten der Sondernutzungen des öffentlichen Raumes werden Genehmigungen erteilt, soweit es die Örtlichkeit zulässt:
- Tische und Sitzgelegenheiten zu gewerblichen Zwecken (Außengastronomie)
- Warenauslagen (Obst, Gemüse, Blumen, Zeitschriften, Bücher, Kleiderständer usw.)
- Werbetafeln (Werbeaufsteller)
- Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen (Straßenfeste, Schützenfeste, Trödelmärkte)
- Werbung (Promotionsstände, Flyerverteilung, Produktproben usw.)
- Filmaufnahmen (Sperrung von Straßen)
- Plakatierungen zur Ankündigung von Zirkusgastspielen, Wahlwerbung, Messeplakatierung
- Aufstellung von Fahrradständern auf öffentlichen Flächen
- Straßenhandel (Speiseeis, Obst, Gemüse, Blumen) in ambulanter Form, d.h. beweglich ohne Einnahme eines festen Standplatzes.
Hygiene
Wenn der Sommer beginnt, haben Eisdielen und Biergärten Hochsaison. Doch gerade bei wärmeren Temperaturen darf die Betriebshygiene keinesfalls vernachlässigt werden, da sich bei erhöhten Temperaturen Keime und Krankheitserreger schnell verbreiten können.
Daher ist es wichtig, dass die Vorschriften zur Hygiene in Gaststätten, insbesondere die Lebensmittelhygiene-Verordnung, genau eingehalten werden. Zum einen müssen Arbeitgeber darauf achten, dass nur Personen mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, die aufgrund einer Schulung Fachkenntnisse im Bereich der Lebensmittelhygiene aufweisen können. Außerdem dürfen Lebensmittel nur so hergestellt und verarbeitet werden, dass sie bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt der Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung nicht ausgesetzt sind.
Wird gegen die Verordnung verstoßen, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, für die ein Bußgeld verhängt werden kann.
Weitere Informationen und Antworten auf Ihre Fragen erhalten Sie beim
Team Sach- und Fachkunde
E-Mail: sfk@essen.ihk.de
Tel: 0201 1892 2430
Ferienjobs für Schüler und Studenten
Kurzfristiger Minijob: Der klassische, “echte” Ferienjob
Oft werden Schüler und Studenten durch einen “kurzfristigen Minijob” angestellt. Diese werden steuerlich behandelt wie kurzfristige Beschäftigte. Man spricht in diesem Fall häufiger von einem „echten Ferienjob”. Diese Begrifflichkeit ist angebracht, wenn Jugendliche nur während ihrer Schulferien arbeiten und die Bezahlung über der Minijob-Verdienstgrenze liegt.
Diese kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse sind sozialversicherungsfrei, aber steuerpflichtig (auch wenn i. d. R. kein Steuerabzug erfolgt). Sie müssen bei der Minijobzentrale an- und abgemeldet werden.
Diese Vereinfachung ist jedoch an einige zeitliche Voraussetzungen gekoppelt: Die Tätigkeit muss im Voraus vertraglich oder nach ihrer Eigenart zeitlich auf nicht mehr als drei Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage innerhalb eines Kalenderjahres angelegt sein. Von dem Drei-Monats-Zeitraum ist nur dann auszugehen, wenn der Minijob an mindestens fünf Tagen in der Woche ausgeübt wird. Bei Beschäftigungen an regelmäßig weniger als fünf Tagen in der Woche ist auf den Zeitraum von 70 Arbeitstagen abzustellen. Mehrere aufeinanderfolgende kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse müssen miteinander verrechnet werden.
Die Höhe des Einkommens spielt bei der kurzfristigen Beschäftigung – anders als bei den 556 Euro Minijobs –keine Rolle. Arbeitgeber sollten, wenn sie mehr als 556 Euro im Monat an Lohn zahlen, darauf achten, dass die Beschäftigung nicht berufsmäßig ausgeübt wird. Dies würde ansonsten wieder zu einer Sozialversicherungspflicht führen.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Merkblatt Teilzeitbeschäftigung..
Mindestlohn
Für Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Ausbildung gilt der allgemeine Mindestlohn nicht. Dagegen gilt der Mindestlohn für Schüler, wenn sie 18 Jahre oder älter sind oder bereits über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen.
Mit Vollendung des 15. Lebensjahres werden Kinder rechtlich zu Jugendlichen. Während der Schulferien dürfen Schülerinnen und Schüler über 15 Jahre einen Ferienjob von höchstens vier Wochen im Kalenderjahr ausüben. Sie dürfen bis zu acht Stunden täglich zwischen 06.00 und 20.00 Uhr beschäftigt werden. Für Jugendliche gilt die Fünf-Tage-Woche und ein Verbot der Beschäftigung an Samstagen und Sonntagen. Bei öffentlichen Konzerten, beim Theater und bei ähnlichen Veranstaltungen dürfen sie nur aufgrund einer besonderen Ausnahmegenehmigung mitwirken. Gefährliche
Arbeiten sind grundsätzlich unzulässig, vor allem Arbeiten, die die Leistungsfähigkeit von Jugendlichen übersteigen, oder solche, die mit besonderen Unfallgefahren verbunden sind. Auch dürfen Jugendliche keine Tätigkeiten ausüben, bei denen sie außergewöhnlicher Hitze, Kälte und Nässe oder gesundheitsschädlichem Lärm, gefährlichen Strahlen und gefährlichen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind. Akkordarbeit und andere tempoabhängige Arbeit ist für Jugendliche verboten.
Von der Samstagsruhe sind in § 16 Abs. 2 JArbSchG Ausnahmen für Krankenhäuser, Bäckereien, Gaststätten, Theater u. a. geregelt. Gleiches gilt für die Sonntagsruhe in § 17 Abs. 2 JArbSchG. Allerdings ist in den vorgenannten Sonderfällen durch Freistellung an den Wochentagen bei Wochenendarbeit immer eine Fünf-Tage-Woche einzuhalten, §§ 15, 16 Abs. 3 und 17 Abs. 3 JArbSchG. Es ist zu beachten, dass zwischen zwei Arbeitstagen eine Pause von mindestens 12 Stunden liegt und die 2 freien Tage aufeinanderfolgen.
Vor Einstellung für einen Ferienjob sollte unbedingt eine schriftliche Erlaubnis der Eltern und eine Ausweiskopie des Jugendlichen vorliegen, die Dauer und Art der Tätigkeit sowie die Höhe der Vergütung schriftlich festgehalten sowie die Tätigkeit bei der Berufsgenossenschaft angezeigt werden. Im Übrigen ist jeder Arbeitgeber, der Jugendliche beschäftigt, verpflichtet, einen Abdruck des Jugendarbeitsschutzgesetzes im Betrieb auszuhängen, auszulegen oder digital zur Verfügung zu stellen.
Die Einhaltung des Kinder- und Jugendarbeitsschutzes überwachen die Aufsichtsbehörden der Bundesländer. Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz können als Ordnungswidrigkeiten, in schweren Fällen sogar als Straftaten verfolgt und mit Geldbußen bis zu 15.000 Euro belegt werden.
Studierende, Praktikanten und Auszubildende
Für Studierende, die keine Werkstudenten sind, sowie Schülerinnen und Schüler gelten hinsichtlich einer geringfügigen Beschäftigung keine Besonderheiten.
Für Auszubildende kommt eine geringfügige Beschäftigung nicht in Betracht, es liegt stets eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vor. Bei Praktikantinnen und Praktikanten, die ein Zwischenpraktikum bei bestehender Immatrikulation absolvieren, ist zu unterscheiden, ob es sich um ein Pflichtpraktikum oder um ein freiwilliges Praktikum handelt. Ein Pflichtpraktikum ist ,unabhängig von der Entgelthöhe, versicherungsfrei in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung.
Das Mindestlohngesetz ist dann nicht anwendbar. Die Ausgestaltung eines solchen Praktikums unterliegt allein eventuellen hochschulrechtlichen Bestimmungen. Versicherungspflicht besteht jedoch in der Unfallversicherung. Für Praktika, die während des Studiums ausgeübt werden, ohne dass sie in der Studien- oder Prüfungsordnung vorgeschrieben sind, besteht in der Rentenversicherung zwar Versicherungsfreiheit im Rahmen von kurzfristigen Beschäftigungen aber Mindestlohnpflicht.
Open Air Veranstaltungen
Gerade im Sommer bietet es sich an, Veranstaltungen, insbesondere Konzerte, nach draußen zu verlegen. Aber welche Vorschriften müssen Gewerbetreibende und Veranstalter beachten, wenn Minderjährige teilnehmen? Und welche Regelungen sind zu berücksichtigen, wenn Musik oder Filme der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden?
1. Jugendschutz
Zunächst müssen Veranstalter die Bestimmungen zum Jugendschutz beachten. Das Jugendschutzgesetz enthält differenzierte Bestimmungen, um Minderjährige in der Öffentlichkeit und im Bereich der Medien effektiv zu schützen. Je nach Alter der Minderjährigen sind die Bestimmungen für die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen oder den Zugang zu bestimmten Orten unterschiedlich geregelt. Informationen für Gewerbetreibende und Veranstalter von öffentlichen Veranstaltungen, an denen auch Minderjährige teilnehmen, finden Sie im Internetangebot der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. (BAJ)
2. GEMA und Rundfunkgebühren
Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) ist eine Verwertungsgesellschaft, deren Aufgabe es ist, Ansprüche aufgrund des Urhebergesetzes für Urheber oder Inhaber wahrzunehmen.
Wenn Musik bei öffentlichen Veranstaltungen abgespielt wird, fallen Lizenzgebühren bei der GEMA an. Dafür müssen alle Veranstaltungen im Vorfeld bei der GEMA angemeldet werden, andernfalls könnten Sie sich schadensersatzpflichtig machen. Eine Veranstaltung gilt generell als öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Personen bestimmt ist, die nicht persönlich untereinander verbunden sind. Informationen rund um dieses Thema finden Sie auf unserer Webseite unter Dok.-Nr. 25407.
Die Rundfunkbeiträge werden dagegen pauschal durch den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice erhoben. Die Pauschale richtet sich für Gewerbetreibende nach der Anzahl ihrer Betriebsstätten, der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und der beitragspflichtigen Kraftfahrzeuge. Zusätzliche Kosten für Veranstaltungen fallen nicht an. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice.
3. Sondernutzung
Möglich ist, dass auch im Zusammenhang mit Open Air Veranstaltungen eine Sondernutzung in Anspruch genommen wird. Dann gelten die o.g. Regeln.